
Das menschliche Gehör ist einer unserer wichtigsten Sinne. Mit ihm können wir uns orientieren und es ist kein Zufall, dass unser Gleichgewichtssinn auch über das Ohr verbunden ist. Das Ohr ist ein kompliziertes System, das sich im Laufe der Evolution verändert hat. Es ist der erste Sinn, der sich, noch im Bauch, beim Embryo entwickelt. In kompletter Dunkelheit kann das Baby bereits Schwingungen wahrnehmen und auch Stimmen erkennen.
Schall wird in Strom umgewandelt
Das Ohr funktioniert nicht viel anders als ein Mikrofon. Schall dringt von außen ein und wird dann in elektrische Impulse umgewandelt, die im Gehirn verarbeitet werden können. Damit ein Geräusch aber auch wirklich in Millisekunden verarbeitet werden kann, braucht es ein ausgefeiltes System. Als erstes erreicht der Schall bei uns die Ohrmuschel. Sie ist wie ein Trichter aufgebaut, nimmt das Geräusch auf und leitet es ins Innere des Ohrs weiter. Die Schallwellen wandern dann erst in den äußeren Gehörgang und gelangen danach ans Trommelfell. Dieses hat seinen Namen nicht von ungefähr: Es schwingt wie die Bespannung einer Trommel, wenn sie geschlagen wird, und leitet die Schwingung dann an das Mittelohr weiter, wo über die Gehörknöchelchen die Lautstärke erhöht wird. Im Innenohr werden die Schwingungen der kleinen Gehörknöchelchen dann in elektrische Impulse umgewandelt. Das geschieht über kleine Haarsinnzellen, die in der Hörschnecke liegen. Sie können die elektrischen Impulse generieren und an den Hörnerv weitergeben.
Das Gehirn macht aus Schall ein Geräus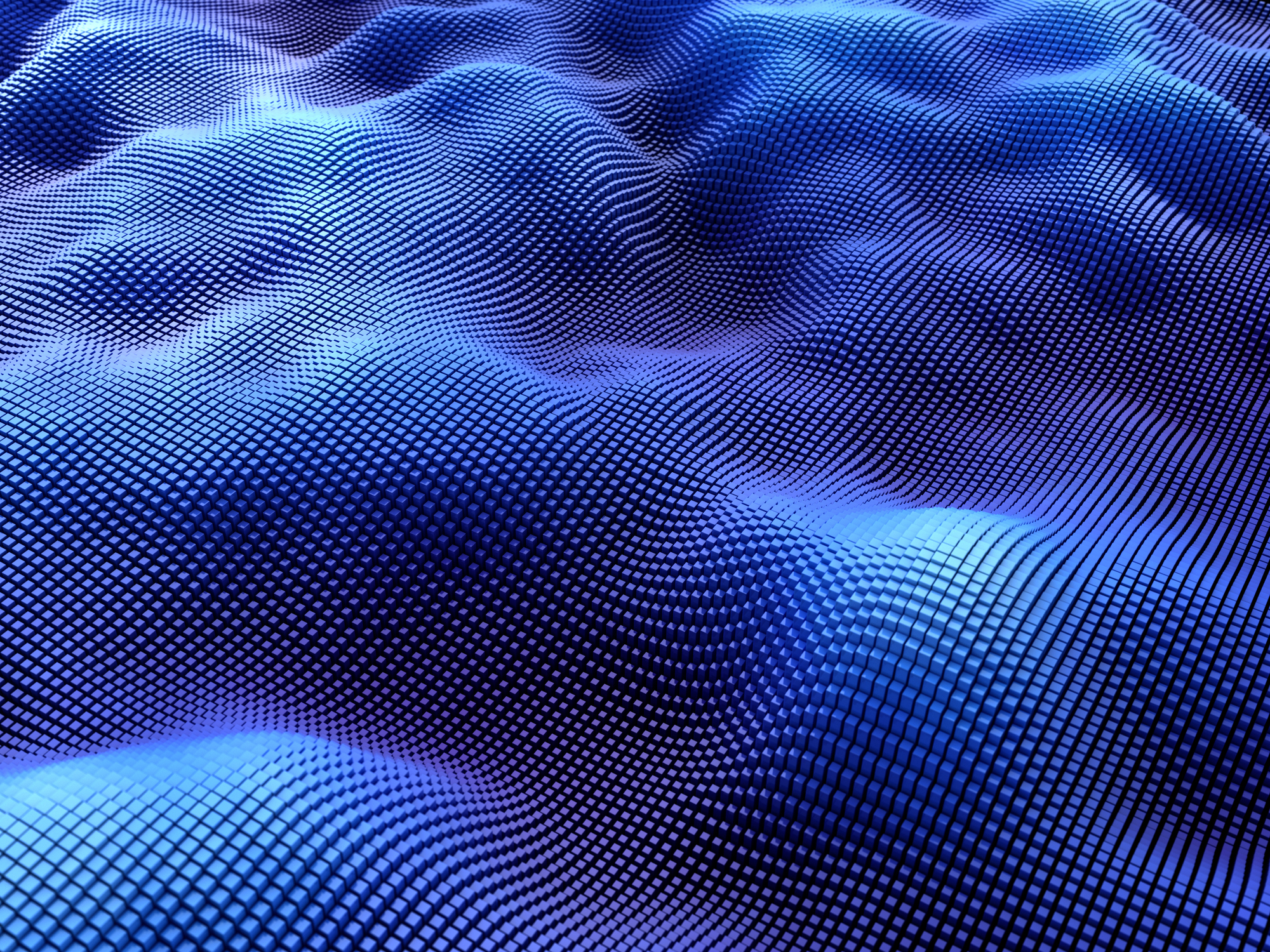 ch
ch
Was wir also als Hören bezeichnen, ist die Übersetzung der Schallwellen durch unser Gehirn. Hier sind es vor allem einzelne Bereiche im Hirnstamm und in der Zwischenrinde, aber auch in der auditiven Hirnrinde, die aus dem Geräuschen letztlich etwas machen, was wir verstehen können. Unser Ohr ist aber eingeschränkt. Es können nämlich aufgrund der physiologischen Konstruktion nur bestimmte Frequenzbereiche aufgenommen werden. Auch ist die Aufnahme des Schalldrucks begrenzt. Im Durchschnitt ist das Leiseste , was wir hören können, ein Schalldruck vom 20 Mikro-Pascal bei einer Frequenz von 2000 Hertz. Damit liegen wir aber immer noch in einem Bereich, in dem wir auch leiseste Geräusche wahrnehmen. Auf der anderen Seite des Spektrums liegt der maximale Schalldruck, der etwa das dreimillionenfache des leisesten Drucks beträgt. Wird dieser überschritten, kann es zu einem organischen Schaden kommen. Umgangssprachlich wird das auch als ein geplatztes Trommelfell bezeichnet. Tatsächlich sind es aber die empfindlichen Haarzellen, die zerstört oder zumindest nachhaltig beschädigt werden.
Dennoch kann auch das Trommelfell Schaden nehmen, vor allem wenn es bei einem zu großen Schalldruck (zum Beispiel einer Explosion) einen Riss bekommt. Man kann aber auch bei der Ohrreinigung mit einem Wattestäbchen sein Trommelfell beschädigen. Gleiches gilt für andere Gegenstände, die man ins Ohr einführt und die ein Loch verursachen können. Dieses kann aber in den meisten Fällen chirurgisch behandelt werden.

